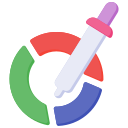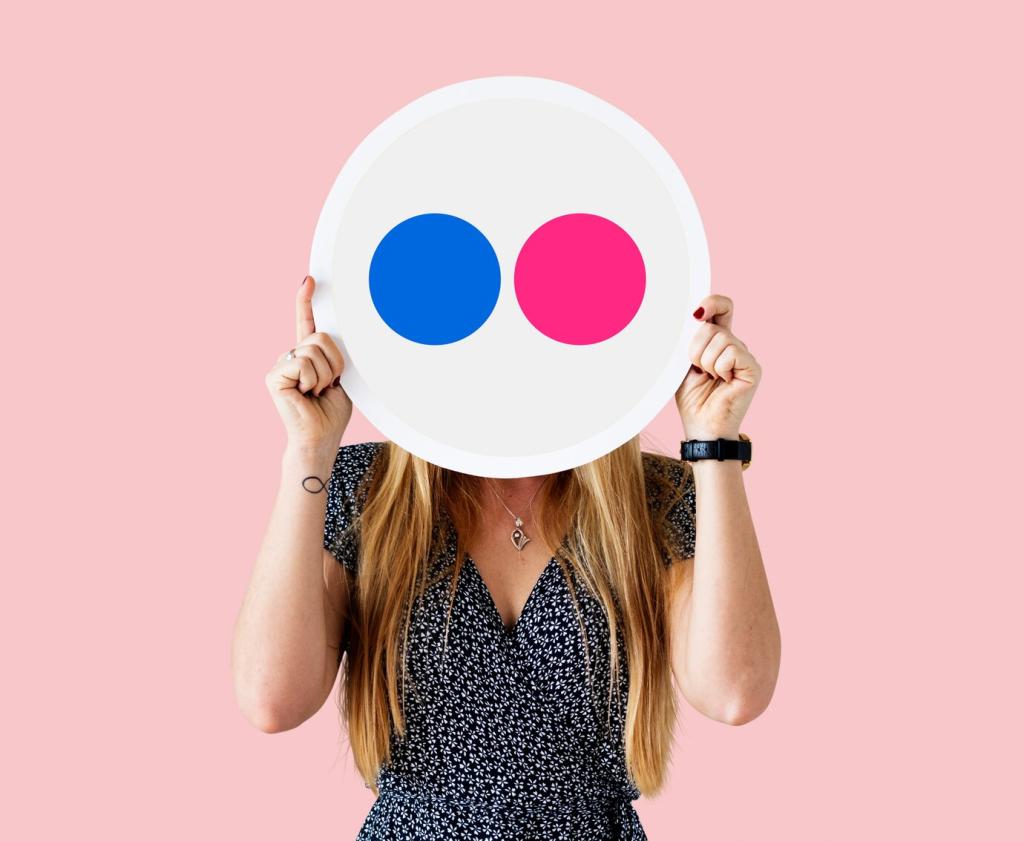Farben fühlen: Wie Töne unsere Emotionen dirigieren
Rot steigert messbar die physiologische Erregung und zieht den Blick magisch an. Von Karmin bis Zinnober nutzen Künstler Rot, um Dringlichkeit, Macht und Leidenschaft zu verdichten, fokale Spannung zu erzeugen und eine unmittelbare, körperlich spürbare Präsenz aufzubauen.
Farben fühlen: Wie Töne unsere Emotionen dirigieren
Blau beruhigt, schafft Distanz und öffnet Weite. Ultramarin wirkt wie ein Fenster zum Offenen; kühlere Blautöne laden zur Kontemplation ein. In Bildern senkt Blau gefühlte Lautstärke, stabilisiert Kompositionen und fördert langes, konzentriertes Schauen ohne Ermüdung.